Ich beschäftige mich fast jeden Tag mit meinem kleinen Sohn. Wir puzzeln, malen oder spielen Memory. Ich lese ihm viel vor und momentan sind Versteckspiele auch ganz hoch im Kurs.
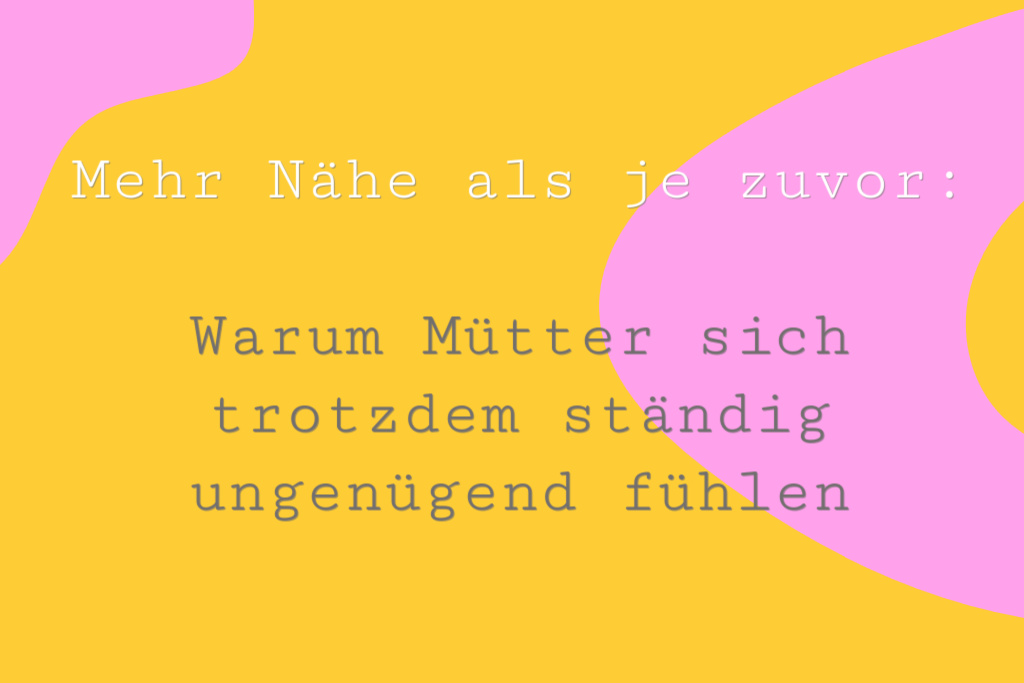
Und trotzdem gibt es diesen leisen Zweifel im Hintergrund, der fragt: „Mach ich genug mit ihm?“ Diese Stimme begleitet viele Mütter meiner Generation. Und sie hat erstaunlich wenig mit der tatsächlichen Zeit zu tun, die wir mit unseren Kindern verbringen.
Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist eines ziemlich klar: Wir verbringen heute mehr Zeit mit unseren Kindern als frühere Generationen. Und fühlen uns gleichzeitig unsicherer und unzulänglicher damit.
Ich kann mich beispielsweise nicht daran erinnern, dass meine Mutter mit mir auf dem Fußboden saß und etwas mit mir gespielt hat. Als wir Kinder größer waren, spielten wir Gesellschaftsspiele am Tisch. Aber ausschließlich an den Wochenenden! Mein Vater las uns gerne Märchen vor. Allerdings geschah das auch nur an den Wochenenden.
Hatte ich eine schlechte Kindheit? Nö!
Ist das nicht paradox?
Früher war Nähe punktuell, heute ist sie permanent
Es gab Zeiten, da war es nicht selbstverständlich, dass Mütter täglich exklusive Zeit mit ihren Kindern verbrachten. Nähe war eingebettet in den Alltag, nicht extra ausgewiesen. Kinder liefen mit. Erwachsene lebten ihr Leben. Gemeinsame Zeit entstand beiläufig: beim Essen, beim Arbeiten, beim Dabeisein. Meine Mutter hängte Wäsche auf, ich baute aus den Klammern eine Schlange. Meine Mutter nähte, ich sortierte die Knöpfe aus ihrer Knopfschachtel nach Größe oder Farben.
Heute ist Nähe etwas, das aktiv hergestellt wird. Sie bekommt auch einen Namen: Quality Time.
Allein dieses Wort verändert alles. Zeit ist nicht mehr einfach Zeit. Sie muss qualitativ hochwertig sein. Achtsam, pädagogisch wertvoll, emotional präsent, bindungsfördernd und entwicklungsrelevant. Plötzlich reicht es nicht mehr, einfach da zu sein.
Mutterschaft unter Dauerbeobachtung
Unsere Generation lebt nicht nur mit Kindern, sondern auch mit einem permanenten inneren Beobachter. Wir bewerten uns ständig selbst.
Habe ich genug gespielt?
War ich geduldig genug?
Habe ich wirklich zugehört?
Hätte ich weniger aufs Handy schauen sollen?
War ich innerlich wirklich präsent?
Diese Fragen tauchen nicht auf, weil wir uns nicht kümmern. Sie tauchen auf, weil wir uns kümmern. Frühere Generationen hatten weniger Wissen über kindliche Entwicklung, weniger psychologische Konzepte, weniger Ratgeber und weniger Vergleichsmöglichkeiten. Nicht zu vergessen: Es gab auch nicht so viel pädagogisches Spielzeug zur Auswahl.
Mehr Wissen, mehr Schuld
Viele von uns haben sich Wissen angeeignet zu Bindungstheorie, Bedürfnisorientierung, Co-Regulation und so weiter. All diese Konzepte sind nicht falsch. Im Gegenteil. Sie haben wichtige blinde Flecken früherer Erziehung sichtbar gemacht. Das Problem entsteht dort, wo Wissen in einen moralischen Maßstab kippt. Denn dann wird aus jeder Alltagssituation eine potenzielle Prüfung.
Wenn Zeit nicht mehr genügt
Ich erlebe es bei mir selbst und höre es von vielen anderen Müttern: Selbst wenn wir uns Zeit nehmen, bleibt das Gefühl, es hätte mehr sein müssen oder anders. Besser! Das ist der entscheidende Punkt:
Wir fühlen uns nicht schlecht, weil wir zu wenig Zeit investieren. Wir fühlen uns schlecht, weil Zeit heute nicht mehr als ausreichend gilt.
Von Beziehung zu Dienstleistung
Unbewusst hat sich das Bild von Elternschaft verschoben. Kinder sind nicht mehr Teil des Lebens der Erwachsenen. Erwachsene werden zu Dienstleistern im Leben der Kinder. Dienstleister aber können nie genug leisten. Denn ihr Wert bemisst sich nicht an Beziehung, sondern an Optimierung. Wir wollen alles richtig machen.
Warum das schlechte Gewissen bleibt
Das schlechte Gewissen verschwindet nicht durch mehr Einsatz. Es wird durch Einsatz genährt.
Denn jedes Mehr setzt einen neuen Maßstab: Gestern habe ich aber länger gespielt. Das letzte Spiel war pädagogisch sinnvoller. Heute habe ich ein schlechtes Gewissen, denn das Kind saß länger vor der Glotze…
Unsicherheit ist kein Zufall
Wir Mütter sind unsicher. Unsichere Mütter konsumieren und vergleichen sich. Sie lesen Ratgeber, buchen Kurse, folgen Accounts auf Social Media. Und sind damit beschäftigt.
Sichere Mütter tun das weniger. Das schlechte Gewissen ist also nicht nur ein Kollateralschaden moderner Mutterschaft. Es ist ein Motor.
Die Illusion der ständigen Präsenz
Ein weiterer Widerspruch unserer Zeit: Wir sollen ständig präsent sein. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, die Dauerpräsenz unmöglich macht. Wir sind berufstätig, leisten Care-Arbeit, leiden unter Mental Load und nebenbei läuft unser Selbstoptimierungs-Programm. Das kann nicht aufgehen.
Was Kinder wirklich brauchen
Kinder brauchen Beziehung. Keine Performance. Sie brauchen Erwachsene, die echt sind. Kinder lernen durch beobachten und können verdammt gut erkennen, wann Mütter nur eine Rolle spielen. Unsere Kinder dürfen sehen, dass wir eine Pause brauchen, dass wir müde sind, dass uns die Hausarbeit nicht gefällt und dass wir nicht immer Lust haben, zu spielen. Wir müssen auch nicht jede Minute mit ihnen pädagogisch nutzen. Wie sollen sie denn sonst lernen, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat? Wie oben schon geschrieben: Ich hatte eine gute Kindheit trotz fehlender Qualitytime mit meiner Mutter.
Ein neuer Blick auf Nähe
Sicherlich ist es nicht zielführend, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen und dabei die ganze Zeit am Handy zu hängen. Aber vielleicht sollten wir unsere Ansprüche an die gemeinsame Zeit mit den Kindern trotzdem herunterschrauben. Nähe darf wieder beiläufig werden, alltagsnah und ungeplant. Nähe ist nicht nur das Memory, sondern auch gemeinsame Hausarbeit. Nähe ist nicht nur der Besuch des Indoor-Spielplatzes, sondern auch zusammen ein Hörspiel zu hören, während man kocht. Nicht jede Minute muss bedeutungsvoll sein und nicht jede Interaktion „pädagogisch wertvoll“.
Fazit
Dass wir uns heute trotz intensiver Mutterschaft schlecht fühlen, ist kein individuelles Problem. Es ist das Ergebnis einer Elternrolle, von der die Gesellschaft immer mehr verlangt. Der Ausweg liegt darin, den eigenen Anspruch an Präsenz zu hinterfragen.
Danke!, dass du darüber schreibst! Das ist so wichtig. Ich habe das bei mir in den letzten Jahren bei mir aufgedeckt und an anderen beobachtet. – Dieses Gefühl nie genug zu sein, obwohl unsere Generation schon so viel anders macht, auf Bedürfnisse achtet, Kinder ernst nimmt, mit ihnen spricht .. und gerade weil wir so viel wissen, und unserern Kindern nicht die selben Verletzungen beifügen wollen, wie wir sie erlebt haben, steigt der selbstgemachte Druck. Ein wichtiger Schritt in Richtugn Veränderung ist genau das zu erkennen.
LikeGefällt 1 Person
Schön, dass dir mein Artikel gefallen hat. Ja, es ist wirklich wichtig, dass zu erkennen.
LikeLike